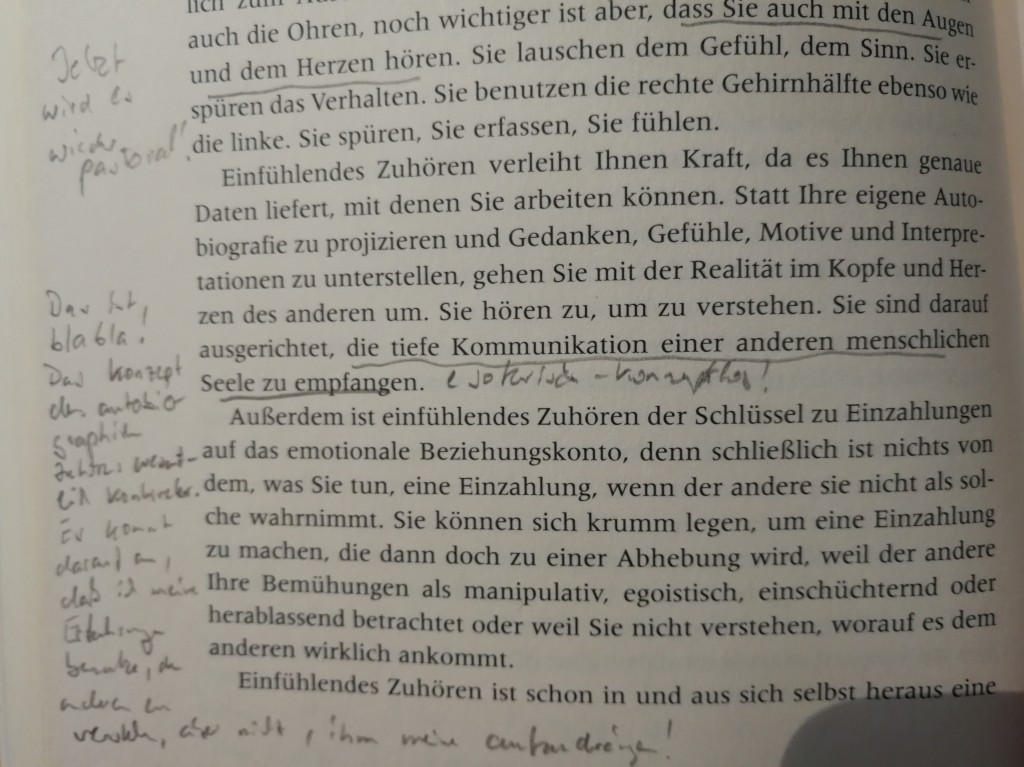Diese Serie entstand zwischen 2013 und 2017 auf Pappe im 20×20-Format nach einem einfachen Prinzip: nach einem ersten Entwurf wird die Pappe um 90 oder 180 gedreht und das Motiv noch einmal über die noch feuchte Farbe gemalt. Dadurch entsteht erstens ein Bildhintergrund (zunächst) in den selben Farben und zweitens vermischen sich die Farben in neuen, ungeahnten Nuancen. Wie unter der Überschrift „Katzen“ üblich füge ich einen weiteren Dialog mit dem Kater Camus hinzu.
Buckeljucken
K
legt eine CD ein. Alle Regler nach links. Es ertönen die „Manic
Street Preachers“. Walisische Rockmusik.
Camus liegt auf dem
Sessel. Dreht ein Ohr in die Lehne, das andere drückt er seine
Pfote.
Camus (schreit):
Was ist denn das für ein Krach!
K: Manic Street Preachers. Eine
in diesem Hause bei Deinem Bediensteten sehr angesagte Band aus
Britannien.
Camus: Gepriesen sei deine Lektüre der
Asterix-Hefte, die auf deinen Sprachstil eine nicht zu überhörende
Wirkung haben. Unüberhörbar ist auch dieser Krach. Ich bin müde.
Ich habe die halbe Nacht die Gegend patrouilliert und die andere
Hälfte dich davon zu überzeugen versucht, mir etwas zu Fressen zu
geben. Jetzt habe ich meinen Schlaf nötig. Schalte das ab!
Sofort!
K: Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und brauche jetzt
diesen Stimmungsaufheller. Etwas zum Mitsingen. Das Singen, das wird
es bringen.
Camus (zu
sich selbst): Jetzt reimt
er auch noch.
K: Das war ein Zitat. Robert Gernhardt – Das
Mäusegedicht.
Camus: Robert kann mich gern hart haben.
K:
‚Und
dräut die Katze noch so sehr
Sie kann uns nicht
verschlingen
solange wir unverzagt
von allem, was noch
ungesagt
von Lust und Frust
von Frist und List
und dem,
was sich sonst noch sagbar ist
nicht schweigen, sondern
singen
Das Singen wird es bringen!‘
Camus: Das ist verbale
und thematische Umweltverschmutzung. Reines Geschwätz. Ihr Menschen
müsst endlich lernen euch kurz und präzise auszudrücken, wie wir
unter uns Katzen: ein gezielter Strahl Urin und alles ist gesagt. Bei
bedeutenden Themen vergräbt man halt eine Kackwurst. Ansonsten ist
man zurückhaltend und geht sich nicht auf den Sack. Kannst Du jetzt
die Musik abstellen?
K: Nein! Die Welt ist komplex und zugleich
so einfach. Das lässt sich nur in der Poesie abbilden. Deswegen ist
Musik so schön, deswegen sind Gedichte so universal.
K
spielt Luftgitarre und posiert vor Camus‘ Sessel.
Camus:
Und sag mal, dieser Robert Gernehart ist ein Poet?
K: War. Leider
schon tot. Hat auch gezeichnet. Ursprünglich liebte er Katzen. In
Italien ist ihm aber später im Leben eine Hündin zugelaufen.
Seitdem war er Hundefreund.
Camus (schaut
schläfrig an die Decke):
Ich glaube, das ist der tiefere Sinn des sprichwörtlichen ‚vor die
Hunde gehen‘.
K: Was?
Camus: Beides.
K: Wie?
Camus
(erhebt sich und macht
einen Buckel): Dieser
italienische Hundeficker und Dein Gehampel. Ihr könnt mir beide den
Buckel herunterrutschen.
K: Woher stammt aber diese Redewendung?
(geht zum Bücherschrank
und blättert in einem Buch.)
Schade, der Ursprung ist nicht geklärt. Heißt aber so viel wie:‘
Lass mich in Ruhe‘.
Camus: Genau. Kannst Du jetzt die Musik
ruhig stellen?
K: Nein, denn ich habe einen breiten Buckel. Und
glaub gar nicht, dass ich vor dir den Buckel krumm mache. Ich habe so
einiges auf dem Buckel und ich brauche mir selbigen nicht
freizuhalten!
Camus: Ich glaube Dein Buckel juckt!
K: Den
Buckel halte ich Dir hin!
Camus: Ich gehe jetzt. Wir sprechen uns
morgen früh. Da haue ich dir den Buckel voll, wenn kein Fressen im
Napf ist.